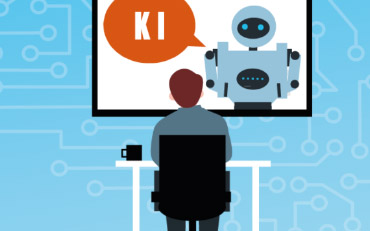Bildungskarenz in Österreich – Stand März 2025

Bildungskarenz in Österreich – Stand März 2025
Die Bildungskarenz, eine beliebte Möglichkeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sich beruflich weiterzubilden oder neue Qualifikationen zu erwerben, steht in Österreich vor tiefgreifenden Veränderungen. Mit dem Ende der staatlichen Förderung durch das Weiterbildungsgeld und das Bildungsteilzeitgeld ab dem 1. April 2025 wird die bisherige Regelung abgeschafft. Dies ist Teil eines umfassenden Sparpakets der neuen Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS, das unter anderem dazu dient, ein EU-Defizitverfahren abzuwenden.
Was bedeutet das konkret?
Ab dem 1. April 2025 können keine neuen Anträge für Bildungskarenz mehr gestellt werden, außer die Vereinbarung mit dem Arbeitgeber wurde bereits bis Ende Februar 2025 getroffen. Für bestehende und bereits genehmigte Fälle gelten Übergangsregelungen: Arbeitnehmer*innen, die ihre Bildungskarenz vor dem Stichtag begonnen haben oder deren Vereinbarung rechtzeitig abgeschlossen wurde, können sie unter den bisherigen Bedingungen ordnungsgemäß abschließen.
Die Abschaffung betrifft nicht die Bildungskarenz selbst. Die Möglichkeit der Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen bleibt weiterhin erhalten. Es entfällt jedoch die finanzielle Unterstützung durch das Arbeitsmarktservice (AMS), was für viele eine erhebliche Hürde darstellen dürfte.
Hintergründe und Kritik
Die Entscheidung zur Abschaffung des Weiterbildungsgeldes wurde unter anderem mit den hohen Kosten begründet: Im Jahr 2023 beliefen sich die Ausgaben auf rund 357 Millionen Euro, exklusive Sozialversicherungsbeiträgen. Zum Vergleich: 2013 lagen die Kosten noch bei 109 Millionen Euro. Die deutlichsten Steigerungen gab es 2022 mit +28% (von 195 Mio. 2021 auf 250 Mio. 2022) und 2023 mit +43%. Für 2024 liegen noch keine Werte vor.
Die nun vorgenommene Maßnahme ist aus der Sicht der Budgetkonsolidierung nachvollziehbar, es stellt sich aber die Frage, ob mit einer kompletten Abschaffung des Weiterbildungsgeldes nicht über das Ziel hinausgeschossen wurde. Arbeitnehmer*innen wird der Zugang zu Weiterbildung dadurch generell erheblich erschwert, was langfristig voraussichtlich negative Auswirkungen auf die Qualifikation der Arbeitskräfte haben wird. Außer Zweifel steht, dass die bisherigen Regelungen zu großzügig waren, weil der Bezug zur beruflichen Praxis einen zu geringen Stellenwert hatte. Das sollte sich aber relativ leicht korrigieren lassen.
Ausblick: Was kommt danach?
Derzeit ist bekannt, dass die Regierung eine Nachfolgeregelung plant, die bis Ende 2025 ausgearbeitet werden soll. Klar ist, dass die Anforderungen höher sein werden. Besonders das de facto zweite Karenzjahr in unmittelbarem Anschluss an die Elternkarenz kann als Geschichte betrachtet werden.
Die finale Ausgestaltung der „Bildungskarenz neu“ wird maßgeblich von den vorhandenen Budgetmitteln abhängen. Und da sieht es bekanntlich dunkelgrau bis schwarz aus.
Fazit
Die Abschaffung der staatlich geförderten Bildungskarenz markiert einen Wendepunkt in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik. Während die Maßnahme kurzfristig Einsparungen bringt, wirft sie langfristig Fragen über die Zukunft von Weiterbildungsmöglichkeiten auf. Arbeitnehmer*innen und Unternehmen sind gleichermaßen gefordert, sich auf die neuen Rahmenbedingungen einzustellen und alternative Wege zur Qualifikation zu finden.
Die Grafik wurde inspiriert von Freepik